|
||||||||||||||||||||
|
Start | Sitemap | Tipps | Anfragen | Publikationen | Neues | Über uns | AGB | Impressum |
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Spuren niederbayerischer Adelssitze im Kreis Rottal-InnBilderreise zu architektonischen und heraldischen Zeugnisse einer süddeutschen KreislandschaftI. Einführung
Namentlich die barocken Zeugnisse des Kreises schlagen sich aber auch häufig in den architektonischen Werken der Schloßbaukunst nieder, die entsprechend ihrem Entstehungsalter, in weit größerer Zahl überliefert sind als beispielsweise die gotischen Bauten des Adels. Ein weiteres Charakteristikum der Herrensitze des Kreises ist, daß von den einst so zahlreich vorhandenen Edelhöfen nur noch wenige übrig geblieben sind, viele in den vergangenen Jahrhunderten abgebrochen, umgebaut oder umwidmet wurden, heute nur noch als Graben, Fundament oder anderweitig genutzt existieren. Vom Mittelalter bis zum 19.Jahrhundert sollen im Kreis "weit über hundert größere und kleinere Herrensitze" bestanden haben; eine vollständige Bestandsaufnahme indes steht noch aus. Ihr massenhaftes Verschwinden fand meist im XIX.Jahrhundert statt, als die Grundrechte des Adels in Bayern aufgehoben wurden und die Herrensitze mit Änderung der Verfassungs- und Sozialstruktur ihre Bedeutung verloren. Aus diesem Grunde ist es etwas mühsamer, aber der Mühe lohnend, sich auf die Spuren des landsässigen niederbayerischen Adels zu begegen und Ausschau zu halten nach dessen Überresten. Trotz des vielfachen Verschwindens adeliger baulicher und gegenständlicher Zeugnisse kann man an versteckten Stellen auf die Spuren ehemaliger Edelleute und deren Familien stoßen; ihr Leben und ihre Vergangenheit kristallisieren sich heute vor allen Dingen an drei Faktoren heraus:
II. Der Kreis Rottal in Vergangenheit und Gegenwart Dieser Kreis wurde erst im Zuge der Gebietsreform 1972 aus Teilen der Altlandkreise Eggenfelden, Pfarrkirchen, Griesbach und Vilsbiburg gebildet. Sitz der Kreisverwaltung ist Pfarrkirchen. Der im südlichen Bereich des Regierungsbezirkes Niederbayern liegende Kreis hat den Inn als Staatsgrenze zu Österreich, gehört daher naturräumlich dem Inn-Isar-Hügelland an. Der prägende Fluß ist die Rott, die den Kreis in West-Ost-Richtung durchfließt. Reichverzweigte Talungen des Inns und der Rott gliedern die Landschaft in viele Höhenrücken und Hügel. Prägend war und ist die Landbewirtschaftung. Durch jahrhundertelange Rodung des hier typischen Laubwaldstockwaldes enstand eine meist durch Ackerfluren und Viehweiden geprägte Kulturlandschaft, die aufgrund der verfassungsrechtlichen Stellung des einheimischen Adels eine gute Möglichkeit bot, Land zu erwerben und als Autorität im Dorfe aufzutreten. Doch sind große Güter mit hunderten von Hektaren, wie in Ostelbien, im Kreis unüblich gewesen. Verwaltungseinheiten waren hier vom Mittelalter an bis zur Ablösung der Grundrechte im XIX.Jahrhundert die sogenannten "Hofmarken", deren meist adelige Inhaber die Niedergerichtsbarkeit innehatten und deren Untertanen nicht dem Landesherrn, sondern dem Hofmarkeninhaber steuerlich verpflichtet waren. Als Wohnsitze dieser Hofmarkeninhaber entstanden dann seit dem Mittelalter nach und nach die Herrensitze, die in der Barockzeit ein Spiegelbild des Absolutismus im Kleinen waren (Ering, Arnstorf, Schönau, Thurnstein). Heute wird wie damals das Siedlungsgefüge entscheidend von den fast gleichmäßig verstreut liegenden Weilern und Einödhöfen geprägt, in der sich nur wenige Kleinstädte befinden. Daher rührt es auch, daß der Kreis heute einer der am wenigsten besiedelten Landschaften in der BRD ist (alte Bundesländer); hier wohnen derzeit nur rund 90 Einwohner pro qkm. Das bedingt ein überdurchschnittlich großes Straßennetz und eine ebenso überdurchschnittliche KFZ-Dichte, zumal die öffentlichen Verkehrsmittel nicht einmal gegenwärtig im Stundentakt verkehren. Mit einer ebensoschlechten Infrastruktur ist daher auch in der Vergangenheit zu rechnen, so daß es weitgehend darauf ankam, die Herrensitze autark zu halten und sich auf die Landwirtschaft zu konzentrieren, obgleich einige Gemeinden und Orte es in der Vergangenheit verstanden hatten, sich vom Adelsherrn ihrer Gegend durch Handel unabhängig zu machen, wie z.B. trat in Triftern bereits früh das Tuchmacherhandwerk auf und verschaffte dem Ort als Markt seit dem XIV.Jahrhundert eine hervorgehobene Stellung. III. Äußere Beschaffenheit Rottaler Herrensitze um 1680
Von den 28 damals von Wening erfaßten Sitzen waren die meisten kleineren Herrensitze (Schernegg, Kirchberg, Wolffsegg, Triftern). Sie bestanden aus einem mehrstöckigen steinernen Gebäude mit Erkern zur Notdurftentsorgung (Wolffsegg, Kirchberg, Brombach) und einem (Malling, Plecking, Schernegg) oder mehreren Türmchen (Panzing, Taufkirchen) auf dem Dach, zum Teil auch mit extra angebauten Türmen, in denen vermutlich die Wendeltreppe untergebracht war und die wohl vielfach auf den mittelalterlichen Bergfried zurückzuführen war (Triftern, Schönau, Seibersdorf, Kirchberg, Wolffsegg, Reichenberg). Die Giebel waren, ja nach ihrer Entstehungszeit, zum Teil mit renaissancetypischen Treppenmotiven verziert (Niederngrasensee, Pantzing, Schernegg) und überwiegend Satteldächer, d.h. spitz zulaufend oder Walmdächer (abgeflachte größere Abschlußneigungen an den Dachgiebelspitzen). Gelegentlich tauchen aber auch Satteldächer mit einem Krüppelwalm
an jedem Giebel (abgeflachte verkleinerte Abschlußneigungen an den
Dachgiebelspitzen) auf. Sattel- oder Walmdach aber waren die ausschließlichen
Dachformen.
Nicht selten bestanden die Sitze als Wasserschlösser mit einem Graben um das Hauptgebäude und einzeln stehende massive Herrenhaus (Afterhausen, Schernegg, Wolffsegg), gelegentlich auch um Gebäudekomplexe mit Herrensitz und Verwaltungs- sowie Wirtschaftsgebäuden innerhalb der Wasserinsel (Hirschhorn), seltener war ein ganzes Schloßgeviert von einem Graben mit Wasser umschlossen (Münchsdorf). Es gab höchst repräsentative Schlösser mit Barockgarten (Gern, Arnstorf, Bayerbach, Ering, Niederngrasensee, Thurnstein) sowie sehr einfache schmucklos aufgeführte, fast verbaut wirkende Sitze (Brombach). An Giebel und Dachschmuck fallen Dachreiter mit Wetterfahnen (Mariakirchen, Arnstorf, Schönau, Seibersdorf) ebenso auf wie - jedoch seltener vorkommend - Schlösser mit imposanten Hirschgeweihen an den Giebelspitzen (Hirschhorn, Plecking) oder großformatigen Sonnenuhren (Plecking) auf. Burgmauern und Zinnen waren schon im 17.Jahrhundert nur noch sporadisch vorhanden (Neudeck, Gern). Während die Herrensitze selbst in Stein erbaut sind, wurden die Wirtschaftsgebäude meist nur in Fachwerk mit Lehm und Holz (Plecking, Malling, Kollersaich) bzw. ganz aus Holz (Panzing) angefertigt, jedoch waren sie bei den großen Barockanlagen durchweg aus festem Stein erbaut (Ering, Bayerbach, Thurnstein). Zur Eigenversorgung war überall ein eigener Garten vorhanden, z.T. innerhalb der Mauern (Thurnstein, Ering, Bayerbach), zum Teil auch außerhalb derselben (Panzing, Malling, Niederngrasensee). Bei den Wasserburgen verband eine Brücke die Anlage mit dem gegenüberliegenden Ufer. Meist handelte es sich damals um 1680 bereits um feste nicht mehr als Zugbrücken zu verwendende Brücken (Schönau, Schernegg) aus Holz (Wolffsegg, Hirschhorn) oder Stein (Münchsdorf), mit einfachem Geländer (Marienkirch) oder prunkvoller Verzierung (Bayerbach). Zwiebeltürmchen waren selten und traten fast ausschließlich bei den großen Anlagen auf (Thurnstein, Bayerbach), sehr selten nur bei kleinen Sitzen (Wolfsegg). Von der Anlage der schlößlichen Gebäudekomplexe entsprachen die mittelaltelrichen Trutzburgen einem zusammengedrängten Klotzbau, in sich verschachtelt, nach außen trutzig und wehrhaft (Baumgarten, Niederngrasensee, Kirchberg, Wolffsegg, Neudeck) und nur die großzügig nicht mehr auf Feindabwehrung, sondern auf höfische Repräsentation ausgelegten Schlösser tragen den Charakter offenherziger Bauten (Thurnstein, Ering, Bayerbach). An Schloß Baumgarten läßt sich dieser mittelalterliche Charakter noch sehr gut ablesen. Auffallend ist an vielen Herrensitzen aus Wenings Abbildungen die Nähe der beiden Autoritäten, die das frühneuzeitliche Leben der Dorfbevölkerungen bestimmte: Die die geistliche Macht symbolisierende Kirche befand sich meist in unmittelbarer (Triftern, Ering, Afterhausen, Baumgarten) oder zumindest mittelbarer Nähe des weltlichen Schlosses (Niederngrasensee, Julbach, Bayerbach), wenn nicht sogar in den mittelalterlichen Burgkomplex vollständig eingebunden (Reichenberg). Diese Beobachtungen stützt auch die bisherige Forschung, die allerdings merkwürdigerweise eine wie oben genannte visuelle Analyse der Weningschen Kupferstiche - bei aller Vorsichtigkeit der vielleicht nicht immer realen Abbildungstreue bei Wening - bislang noch nicht durchgeführt hat: "Von den großen mittelalterlichen Burgen des Rottals steht heute keine einzige mehr. Diese Festungen und Symbole stolzer Adelsmacht fielen als erstes den verschiedenen Kriegszügen zum Opfer, die ab dem beginnenden 16.Jahrhundert das Rottal verwüsteten. Anders verhielt es sich mit den Adelssitzen, die inmitten oder am Rande der Siedlungen ihrer Grunduntertanen gelegen waren. Diese waren ohnehin nie ernst zu nehmende Festungen gewesen, wenn auch die dem Adel zustehenden architektonischen Würdesymbole wie Türme, Zinnen, Wall und Graben, die Distanz zu den Häusern der Bürger und Bauern herstellten ... Die Strukturen der niederbayerischen Herrensitze, zumal der Rottaler Hofmarken, ähnelten im Prinzip der antiken Villa rustica und den Landvillen des venezianischen Patriziats des 15. und 16.Jahrhunderts, die gleichfalls den Typ des herrschaftlichen Landsitzes mit charakteristischer Repräsentationsarchitektur verbunden hatten." Wie wir sahen, zählten zu den ehemals im Kreis vorhandenen Schlössern zählten am Ende des XVII.Jahrhunderts noch mindestens 28 Stück. Wie sahen sie aus und was ist aus ihnen geworden? Edelsitz Triftern, ein mehrgeschossiges steinerens schlichtes Gebäude, heute noch in Teilen existent, der dortige Ortsadel trat erst relativ spät, im XIV.Jahrhundert, in Erscheinung, obgleich es bereits im 12.Jahrhundert in den benachbarten, später eingemeindeten Orten Edelleute gegeben hat (1145 Erwähnung Schloß Loderham). Der Edelhof, der später mit einem Wohngebäude - einem zweigeschossigen Barockbau des ehemaligen Herrensitzes - bis 1973 als Rathaus genutzt wurde, steht noch heute, ist aber baulich kaum mehr erkennbar, besitzt jedoch noch den für die kleineren Herrensitze des Rottales typischen massiven zweigeschossigen rechteckigen Bau mit einem Krüppelwalmdachaufsatz. Vom Kellergewölbe aus war ein Eingang zu einem unterirdischen Gang vorhanden. Ein anderes dem Schloßkomplex zugehöriges Gebäude aus dem XVI.Jahrhundert steht noch unmittelbar östlich der Kirche (ein schmaler dreigeschossiger Bau wohl des mit hohem steilem Walmdach), konnte aber bei einer Besichtigung durch den Verfasser nicht mehr identifiziert werden. Der Inhaber der sogenannten Sitzhofes bei Triftern, einem schon
im IX.Jahrhundert nach Christus erstmalig urkundlich erwähnten Ort,
besaß auch die Niedergerichtsbarkeit. Ende des XVI.Jahrhunderts lassen
sich als Besitzer des Hofes zu Triftern die Familie der Schenk v.Staufen
und die der Grafen Lodron nachweisen.
Auch die Barone Notthafft v.Weißenstein, die Grafen v.Königsfeld, die Barone v.Docfort, die v.Berchem und zuletzt die Freiherren v.Hackled wurden in der Folgezeit als Besitzer genannt. Der Letztgenannte trat den Herrensitz Triftern schließlich zu Beginn des XIX.Jahrhunderts an den bayerischen Staat ab, danach gab es nur noch nichtadelige Besitzer. In der Pfarreikirche St.Stephan zu Triftern befindet sich noch heute ein Grabstein mit einem Allianzwappen der Grafen v.Lodron und der Freiherren v.Docfort. Beerdigt wurde hier die im Juni 1756 im Alter von 63 Jahren verstorbene Maria Anna Barbara Gräfin v.Lodron, "Frau zu Trüfftern, Türken und Lechen", geborene Freiin v.Docfort, Witwe des ehemaligen Kämmerers Grafen Georg Anton v.Lodron. Das Allianzwappen unter einer Krone zweigt das gräfliche und
freiherrliche Wappen zusammen unter einer Grafenkrone, vom Betrachter der
Grabplatte aus links erkennt man das Wappenschild der heute noch in Italien
blühenden Familie der Grafen v.Lodrons (einen Löwen), rechts
das Wappenbild der Freiherren v.Docfort.
In der Nähe von Triftern befindet sich noch ein anderer Herrensitz,
von dem wir schon hörten: Loderham. Dieses noch heute existierende
Haus wurde 1726 durch die Familie v.Cronegk neu erbaut. Es handelt sich
um ein kleines Herrenhaus mit Walmdach und geziegelter Torbogeneinfahrt
im Markt Triftern: "Schloß" Loderham, ehemals bereits um 1145 nachweisbar
und zuletzt in adeligem Besitz der nunmehr erloschenen Freiherren Fleißner
v.Wostrowitz.
Zur Erinnerung an die letzte Witwe des Schloßherrn, die eine
begeisterte Malerin war und mit finanziellen Spenden die Gemeindeeinrichtungen
unterstützte, trägt der neue Kindergarten in dem Gemeindeteil
Anzenkirchen heute den Namen "Freifrau-Fleißner-v.Wostrowitz-Kindergarten".
Gut Kollersaich, zur Zeit Wenings am Ende des 17.Jahrhunderts im Besitz des Kurfürstl. Hofkammerpräsidenten Freiherr v.Scharffsed, heute nicht mehr existent. Typisch für einen wenig repräsentativen, fast bäuerlich anmutenden Sitz, der auf hohe Stockwerke verzichtet hatte und die Wirtschaftsbegäude nicht überragte. Schloß Afterhausen, ein Wasserschlößchen mit Turmreiter, ehemals im Besitz der Herren v.Thurnstein, nur noch der Graben andeutungsweise vorhanden. Schloß Arnstorf, hier gab es ein auf ein im 15.Jahrhundert
zurückzuführendes sogenanntes Oberes Schloß aus dem Beginn
des 17.Jahrhunderts und ein Oberes Schloß, das durch eine Herrschaftsteilung
der Freiherren v.Closen entstanden war. Diese Familie war bereits früh
Inhaber der Arnstorfer Hofmark. 1766
wurden einige von ihnen in den Grafenstand erhoben. Bis 1847 im Besitz
der Freiherren v.Closen, die ausstarben, seither durch Vermählungsgang
im Besitz der Grafen Deym v.Stritez, ehemaliges Fideikommiß. Im Inneren
1724 entstandene barocke Ausgestaltung.
Schloß Baumgarten, seit 1821 im Besitz der Grafen Arco
v.Valley. Erbaut von Conrad v.Pienzenau um 1570.
Schloß Bayerbach, ein schon im 16.Jahrhundert abgetragener Bau, danach ein Neubau, zweiflügelig mit drei runden Ecktürmen, nicht mehr existent. Schloß Brombach, mittelalterlicher Sitz der v.Brombach, heute nicht mehr vorhanden. Schloß Ering, ehemals mit Barockgarten, heute noch erhalten ist der Südostflügel, der 1975 im Besitz einer Gräfin v.Esterhazy war. Ein 1722 entstandener Festsaal ist in Rokokomanier ausgestattet. Schloß Gern, seit dem 14.Jahrhundert im Besitz der Freiherren v.Closen, war von allen Schloßanlagen im Kreis die großzügist angelegte, brannte aber 1921 ab. Sie ist das typische Beispiel einer adeligen Hofmark (sogenannter "gotischer Stadel") und noch heute als solche erkennbar durch die Anordnung der Ökonomiegebäude und den Wohnhäusern der ehemaligen Hofmarksuntertanen. Eine im Kern mittelalterliche Wasserburg wurde allerdings bereits im Österreichischen Erbfolgekrieg im 18.Jahrhundert zerstört. Schloß Hirschhorn, Doppelhaus aus Stein mit Walmdach,
im 18.Jahrhundert umgestaltet, doch schon früher erbaut.
Schloß Kirchberg, nicht mehr vorhanden, ein kleinerer Herrensitz. Schloß Malgersdorf, ehemals ein hölzernes Schloß, später im Stil um 1700 in Stein daneben erbaut von den Freiherren v.Trauner. Schloß Malling, vor 1697 durch einen Brand vernichtet, wiederaufgebaut, heute jedoch nicht mehr existent. Schloß Mariakirchen, ein imposantes Wasserschloß
aus dem 16.Jahrhundert, war 1979 im Besitz der Grafen Deym v.Stritez. Der
rechteckige und vierflügelige Bau aus dem 16.Jahrhundert ist architektonisch
auch heute noch ein bedeutendes Denkmal der von der Renaissance beinflußten
Baukunst des Rottales.
Schloß Münchsdorf, eine ehemals vierflügelige
Anlage mit Innenhof. Nach dem Abriß des alten Schlosses war dort
1979 die Schloßgärtnerei des Freiherrn v.Aretin untergebacht.
Auf dem nahegelegenden Friedhof befindet sich das Grab des bekannten Schriftstellers
und Monarchisten Dr. Erwein Frhr.v.Aretin, Mitglied des Deutschen Adelsrechtsausschusses.
Schloß Neudeck, gehörte im Mittelalter dem gleichnamigen Geschlecht v.Neudeck, bis 1805 besaßen es die Grafen v.Ortenburg, danach der bayerische Staat, der den mittelalterlichen Sitz abtragen ließ. Schloß Niederngrasensee, ein Herrensitz der Familie v.Grasensee, bereits in der ersten Hälfte des 12.Jahrhunderts erwähnt. Liegt in der Nähe der Kreisstadt Pfarrkirchen. Der hochrechteckige Giebelbau war mit einem Wassergraben umgeben, wurde aber schon zu Anfang des 19.Jahrhunderts abgerissen.
Schloß Peterskirchen. Der noch vorhandene Frührenaissancebau gehörte lange Zeit den Herren v.Baumgarten. Schloß Plecking, ein hochgiebeliges Schloß, ist heute ein Weiler bei Taufkirchen in der Gemeinde Falkenberg. Schloß Reichenberg, ein großzügige Burg mit Bergfried und vielen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, diente u.a. als Sitz des herzoglichen Pfleggerichts und dann als fürstliches Jagdschloß, 1804 abgerissen. Tätig war auf dem Schloß u.a. Andreas Kolb v.Raindorf als herzoglicher Pfleger (Verwaltungsbeamter), dessen prachtvolles Epitaph in der Stadtkirche zu Pfarrkirchen erhalten geblieben ist (siehe unten Abschnitt "V. Adelige Grabdenkmäler" dieses Artikels). Schloß Ritzing, schon mit mittelalterlichem Baugrund, noch existent. Schloß Schernegg, ehemaliges Wasserschloß, heute nur noch als Erdwall vorhanden. Schloß Schönau, im Kern mittelalterlich, von den heute noch im Kreis vorhandenen Schlössern mit Sicherheit das Romantischste mit 1900-1903 errrichteten verwinkelten historisierenden Bauzügen, Türmchen und Zinnen. Wassergraben rundherum mit Karpfen. Gepflegter englischer Landschaftspark mit Büsten und Plastiken, Seit dem 17.Jahrhundert im Besitz der Freiherren Riederer v.Paar, die den Namen des Schlosses in ihren Namen aufnahmen ("Frhrn. Riederer v.Paar zu Schönau"). Schloß Seibersdorf, ebenfalls schon eine mittelaltelriche Bauaufführung, von der noch der untere Teil des Wohngebäudes vorhanden ist. Schloß Taufkirchen, vorhanden heute noch als zweigeschossige Anlage, die 1979 als Pfarrhof diente. Schloß Thurnstein, eine der bedeutensten Barockanlagen des Kreises in der Nähe von Postmünster. Thurnstein ist eines der wenigen noch bewohnten Schlösser des Kreises und befindet sich seit mehr als zwei Jahrzehnten im Besitz der Familie der Grafen Basselet de la Rosée. Nach 1689 wurde von den zu Grafen standeserhobenen Familie v.Imsland der barocke Neubau errichtet, der 1782 von den standeserhobenen Grafen v.Goder erweitert wurde. die Schloßkapelle ist noch heute ein bedeutendes Zeugnis der barocken Baukunst der Gegend. Schloß Wolfsegg bei Massing, eine zweiteilige Burganlage mit Zweibeltürmchen, heute nicht mehr vorhanden. IV. Kommunalwappen mit entlehnten Adelsheraldika
Hirschgeweih und Rosenzweig der Gemeinde Bad Birnbach sind dem Wappen der Freiherren v.Schmid entlehnt, der goldene Sparren im Wappen des Ortes Dietersburg stammt von den v.Baumgarten (goldener Sparren) und der erloschenen Grafen v.Hals (gesenkter Balken), die fünf Sterne im Wappen von Schönau entstamen dem Familienwappen der Riederer v.Paar und die drei Rosen im Ortswappen von Simbach am Inn stammen von den Grafen v.Toerring, die hier lange die Hofmarksherrschaft innehatten. V. Adelige Grabdenkmäler Auch verschiedene heute noch vorhandene Grabdenkmäler zeugen in Kirchen und auf Friedhöfen vom ehemaligen Leben des niederbayerischen Adels. Exemplarisch seien herausgegriffen die Kirchen und Kapellen der Kreisstadt Pfarrkirchen, wobei es sich bei den hier Beigesetzten meist um Angehörige ausgestorbener Familien handelt. Wolf Ehrenreich v.Pürings Grabstein (1603) befindet sich heute im Vorraum der Stadtpfarrkirche, Barbara Kolb v.Raindorfs Grabstele (1663) ist an der südlichen Außenwand der Stadtpfarrkirche befestigt, Andreas Kolb v.Raindorf (1666) liegt in der Stadtpfarrkirche begraben, Johann Martin v.Edelbecks (1682) Grabplatte befindet sich hingegen im südlichen Seitenschiff der Stadtpfarrkirche, Ignatz v.Hormayrs (1706) sepulkraler Gedenkstein steht im Vorraum der Stadtpfarrkirche, während die Grabmäler von Joseph Franz Frhr.v.Edelbeck (1730), Johann Nepomuk v.Hötzl (1778) und Margaretha v.Gugler (1790) in der Allerseelenkapelle zu Pfarrkirchen untergebracht sind. Gelegentlich kann es auf ausgesprochen bäuerlich dominierten Dorffriedhöfen zu echten Überraschungen kommen. So befindet sich auf dem katholischen Kirchhof zu Triftern ein merkwürdiges adeliges Grabdenkmal, welches man hier nie vermuten würde. Der über dem Dorf an einem Hügel belegene Friedhof ist streng symetrisch angelegt worden. Er fällt dem Besucher vor allem wegen seiner Sterilität auf, denn viele Grablegen sind mit riesigen Steinplatten zugedeckt und dort wo sich Erde befindet, ist sie tiefschwarz und größtenteils unbewachsen. an der Stirnseite des Friedhofs, die sich am höchsten Punkt befindet, sind größere Steinplatten in einer backsteinerne Mauer eingelassen; hier liegen hauptsächlich Ortshonoratioren, während der Friedhof selbst von "Bauern" und "Austragsbauern" dominiert wird, deren Berufe und Herkunftsorte ebenfalls auf den Grabsteinen vermerkt ist, oft unter Verwendung der für norddeutsche Augen verwirrenden Abkürzung "v." ("Austragsbauer v.Osten" = ist kein Adelszeichen, sondern eine Ortsbezeichnung!). Auffallend ist in Triftern eine vollkommen aus der Symetrik ausbrechende Grabplatte, die an der Stirnseite links an der Backsteinmauer angebracht ist. Es handelt sich um eine kleine Erinnerungsplatte aus Stein, die zwischen zwei großen eingelassenen Platten angebracht wurde und an die ostdeutsche Familie v.Helden-Sarnowski erinnert; zugleich ist sie die einzige Gedenkstätte einer (erloschenen) )adeligen Familie auf diesem Kirchhof. VI. Fazit
|
||||||||||||||||||||
|
© Institut Deutsche Adelsforschung - Quellenvermittlung für Wissenschaft, Familienforschung, Ahnenforschung | Seitenanfang |

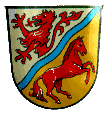 Auch
heraldisch hat sich viel vom ehemaligen Adel im Landkreis Rottal am Inn
erhalten. Das Kreiswappen Rottal am Inn zeigt unter anderem einen roten
Pantherstumpf, das Wappenzeichen der Grafen v.Spanheim-Ortenburg, Arnstorf
erhielt den Schwan und die Wappenfarben schwarz und golden der v.Closen
ins Kommunalwappen, der Ort Bayerbach integriert in sienem Wappen gleich
Motive von zwei am Ort bedeutenden Adelsfamilien: v.Tattenbach (geschuppter
Schrägbalken) und v.Eßwurm (Drache).
Auch
heraldisch hat sich viel vom ehemaligen Adel im Landkreis Rottal am Inn
erhalten. Das Kreiswappen Rottal am Inn zeigt unter anderem einen roten
Pantherstumpf, das Wappenzeichen der Grafen v.Spanheim-Ortenburg, Arnstorf
erhielt den Schwan und die Wappenfarben schwarz und golden der v.Closen
ins Kommunalwappen, der Ort Bayerbach integriert in sienem Wappen gleich
Motive von zwei am Ort bedeutenden Adelsfamilien: v.Tattenbach (geschuppter
Schrägbalken) und v.Eßwurm (Drache).