Das Sinnbild des Instituts Deutsche Adelsforschung
Erläuterung zum Inhalt und zur Bedeutung des Reiterlogos
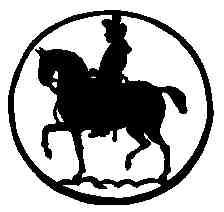
Seit sich das Institut Deutsche Adelsforschung nur noch und ausschließlich
mit der Erforschung des deutschen Niederadels einschließlich der
Grafen- und Freiherrenfamilien in Deutschland befaßt, hat es sich
im Jahre 1998 auch ein eigenes Symbol geschaffen. Es handelt sich dabei
um den nebenstehend abgebildeten Reiter in Form eine Schattenrisses.
Die Idee zu dem Motiv entstammt der Truppengeschichte des Kürassier-Regiments
Königin aus Pasewalk, welches leicht verändert durch eine
Schattenriß ausgeführt worden ist.
Der Vorteil des Scherenschnitts liegt darin, daß man historische
Gegebenheiten rekonstruieren kann, ohne sich an Details halten zu müssen,
die nur schwerlich rekonstruierbar sind. Der Gesamteindruck und nicht das
Detail zählen. Andererseits hat der Schattenriß den Vorteil
der Mehrdeutigkeit, was - wie weiter unten ausgeführt werden wird
- insbesondere beim Reitersinnbild des Instituts Deutsche Adelsforschung
zu bemerken ist. Das Sinnbild besteht aus drei Attributen:
-
Dem Pferd. Es steht als Symbol für vielerlei Verbindungen
zum Adel: Wer ein Reitpferd besaß (und dieses wird hier eindeutig
durch den Dressurschritt gekennzeichnet, welchen kein gewöhnliches
Arbeitspferd beherrschte) demonstrierte nicht nur einen gewissen Wohlstand,
sondern auch erhöhte Mobilität und diese stand für Erfahrung,
Omnipräsenz, Austausch, Bekanntheit, Verknüpfung und soziale
Kontakte sowie Netzwerke. Wer reiste, machte sich bekannt, gab und empfing
Anregungen, erweiterete seine Gedankenwelt. Schon seit den Zeiten der Kreuzzüge
bestand die enge Verbindung zwischen Pferd und Ritter, später dann
in der Kavallerie war das Pferd unentbehrliches Hilfsmittel ebenso wie
auf den großen Gütern Ostelbiens, wo das Pferd zu den wichtigsten
Mitarbeitern zählte und Pferdezucht auf fast jedem Rittergut betrieben
wurde. Die Indienststellung des Pferdes beim deutschen Adel wird hier zusätzlich
durch den kupierten Schwanzschweif des Pferdes symbolisiert, es fügte
sich ein in die Bedürfnisse des Menschen.
-
Dem Edelmann. Aufgrund der Umrißzeichnung bleibt offen
und soll auch offen bleiben, ob es sich um einen Offizier oder einen privaten
zivilen Edelmann handelt, denn den Degen als Zeichen der Wehrhaftigkeit
durften beide tragen. Der Degen, ersichtlich nur am Klingenende unterhalb
des Bauches des Pferdes, steht für die privilegierte Stellung der
deutschen Nobilität und für dessen enge Verbindung zum Militär,
die vor allem die nachgeborenen Söhne veranlaßte, als Truppenführer
in die Heeresdienste einzutreten (zum Teil durch den Landesherren erzwungen,
der, wie einst der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm in Preußen
im 18.Jahrhundert, seinen Adeligen gebot, in seine Heeresdienste einzutreten
und die Annahme fremder Dienste verbot). Weiterhin gekennzeichnet wird
der Edelmann durch seine beiden Kopfbedeckungen. Die am "Peruquenzopfe"
kenntliche Perücke war ein besonderes Merkmal der höheren Stände
und symbolisierte Macht, Einfluß, Wohlstand und Repräsentation,
denn nur wer sich mit fremden und aufwendig in Form gebrachten künstlichen
Haaren schmücken konnte, hob sich von der Allgemeinheit ab. Auch die
zweite Kopfbedeckung zählt zu den Symbolen des Adels: Der Dreispitz mit Puschel.
Dreispitze waren zwar auch Alltagskleidung der Landbevölkerung im
18.Jahrhundert, nicht jedoch mit Puschel, der oft die Landesfarben repräsentierte
und mit einem Amt verbunden war, beispielsweise dem eines Offiziers. Ferner
kennzeichnet der Habitus des Pferdes den Reiter als Edelmann: Des Reittieres
gerader Sitz, der kupierte Schweif, die edle Bewegung und Haltung im Dressurschritt
zeigen Selbstbeherrschung, Zurückdrängung des Individualismus
und Professionalität in allem, was der Adel begann (typische Zeichen
der Nobilität, wenn auch freilich namentlich im Idealbild). Dem entspricht auch die exakt gerade Haltung des Reiters,
der sich nicht etwa gehen läßt. Reiter und Pferd sind optimal
ausgebildet und aufeinander abgestimmt, beide fügen sich in eine Norm,
wie es beim Adel oft zu beobachten ist: Generationen über Generationen
trugen nicht nur die gleichen Vornamen, sondern waren nacheinander Offiziere,
oft im gleichen Regiment. Dies alles versinnbildlicht die Haltung der beiden
dargestellten Lebewesen.
-
Dem Ring. Er verbindet umfassend die oft jahrhundertlange Einheit
zwischen Pferd und Reiter, Haltung und Dienst, die noch heute im Adel in
Form von Parforcejagden, Rennsport, Vermietung von Reitpfernden, der Unterhaltung
von Reitställen und der Pferdezucht lebendig ist. Wenn auch die Bedeutung
des Pferdes für den Adel erheblich zurückgegangen ist,
blieb doch eine besonders innige Verbindung übrig, denn noch im 21.Jahrhundert
gehört das Reiten und die Jagd, zwei besonders naturverbundene Beschäftigungen,
beim Adel zu den beliebtesten und am häufigsten ausgeübten Freizeittätigkeiten.
-
Resumée: Das Reitersymbol steht zeit- und themenübergreifend
für viele einzelne Sinnbilder des deutschen Adels und ist daher ähnlich
wie der Heilige Ritter Sankt Georg im Kampf gegen den das Böse darstellenden
Drachen (dies Sinnbild wurde vom Deutschen Adelsblatt und wird noch heute
von einer Adelsinstitution geführt) besonders geeignet, ein historisch
orientiertes Forschungsinstitut wie das IDA zu symbolisieren.
Literaturhinweise:
- Bidlingmaier, Rolf: Tempel für Pferde!? Marställe und
Reithäuser deutscher Fürsten im 19. und frühen 20. Jahrhundert, in:
Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (Hg.): Hippomanie am Hofe,
Petersberg 2019, Seite 71-85.
- Hauenstein, Isabel: Reitkunst im Dienst des Hofes, in:
Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (Hg.): Hippomanie am Hofe,
Petersberg 2019, Seite 20-27 [betrifft die Bedeutung von Pferden an
Fürstenhöfen].
- Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (Hg.):
Hippomanie am Hofe, Petersberg 2019, 240 Seiten [Themenband mit
Beiträgen betreffend Pferdedressur, Pferdehaltung, Pferdegebäude;
erschien als Band 22 der Reihe „Jahrbuch der Stiftung Thüringer
Schlösser und Gärten. Forschungen und Berichte zu Schlössern, Gärten,
Burgen und Klöstern in Thüringen und seinen europäischen
Nachbarländern“ für das Jahr 2018].
- Cuneo, Pia F.: Das Reiten als Kriegstechnik, als Sport
und als Kunst. Die Körpertechnik des Reitens und gesellschaftliche
Identität im frühneuzeitlichen Deutschland, in: Rebekka von
Mallinckrodt (Hg.): Bewegtes Leben. Körpertechniken in der frühen
Neuzeit, Wiesbaden 2008, Seite 167-187 [betrifft Repräsentationsaspekte
adeligen Reitens].
- Mallinckrodt, Rebekka von: Bewegtes Leben.
Körpertechniken in der Frühen Neuzeit, Wolfenbüttel 2008, VIII und 375
Seiten [Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung schriftlicher und
bildlicher Artefakte in der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel
vom 29. Juni bis 16. November 2008; enthält mehrere Aufsätze im Lichte
der Körpertechnikkonzeptes von Marcel Mauss bezüglich der
Körpertechniken Tennis, Ballspielen, Rhetorik, Haltung, Habitus,
Reiten, Fechten als Adelskünste der Frühneuzeit]
- Krenn, Peter: Eine Adelshochzeit in der Grazer Burg im
Jahre 1591. Zur überragenden Bedeutung des Pferdes bei den höfischen
Festen der Renaissance und des Barock, in: Meinhard Brunner (Hg.):
Haus- und Gebrauchstiere in der steirischen Geschichte (Beiträge einer
Fachtagung der Historischen Landeskommission für Steiermark am 27.
November 2013 in Graz aus Anlass des 75. Geburtstages von
Universitäts-Professor im Ruhestand Dr. Alfred Ableitinger), Graz 2013,
Seite 77-86 [betrifft Adel und Hippologie].
- Rémond des Cours, Nicolas: Die wahren Pflichten des
Soldaten und insonderheit eines Edelmannes, welcher sein Glück in
Kriegsdiensten zu machen suchet. Nebst dem Bilde eines vollkommenen
Officiers, eines ehrlichen Mannes, und eines wahren Christen, Berlin /
Potsdam 2. Auflage 1754, 2 Blatt und 182 Seiten [aus dem Französischen
ins Deutsche übersetzt].
- Krosigk, Eschwin v.: Offizierkorps und Adel in
Geschichte und Gegenwart, in: Deutsches Adelsblatt, Jahrgang XVII,
Kirchbrak 1978, Seite 131-133.
|
